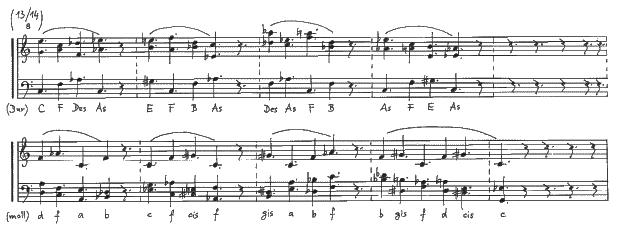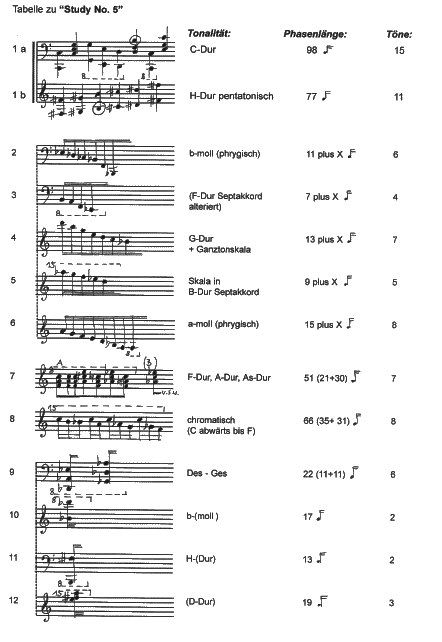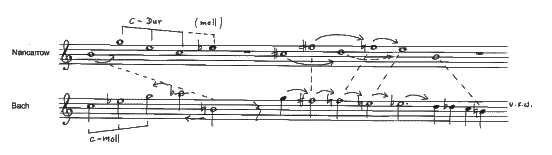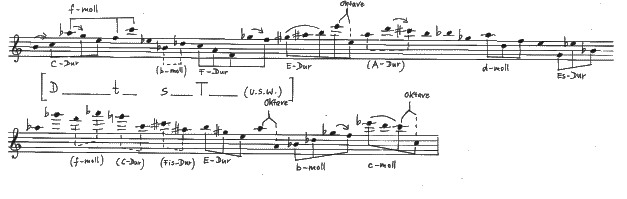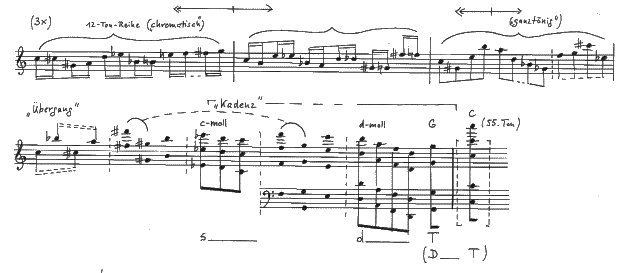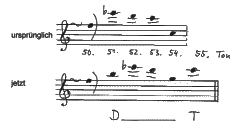|
zurück
"Ich tue, was ich tue, in
meiner eigenen kleinen Nische.
Es ist eine begrenzte Ecke, aber
ich denke, ich habe sie gut erforscht."
(Conlon Nancarrow)
I (Prolog)
Als ich Mitte der 80er
Jahre die Musik von Conlon Nancarrow kennenlernte, ist es mir ergangen wie
vielen anderen meiner Komponisten-Kollegen: ich war überwältigt von den
schier unglaublichen Klangtexturen der „Studies" für das Player-Piano,
die auf ungeheuer faszinierende Art und Weise die scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten metrischer Komplexitäten ausloten und die dafür ein Instrument
nutzen, das seine eigentliche Blütezeit längst hinter sich hatte.
Als reproduzierendes
Instrument und Musikmaschine ein Vorläufer von Radio und Schallplatte kannte
ich das selbstspielende Klavier nur aus dem Museum und wußte von seinem
Einsatz im legendären Skandalstück der 20er Jahre, dem „Ballet
mécanique" von George Antheil. Wie aber hier die genuinen Möglichkeiten
dieses Instrumentes nicht für die Reproduktion einer Interpretation (wofür
das Pianola - wie das selbstspielende Klavier auch genannt wurde - ja
ursprünglich gedacht war), sondern produktiv zur Verwirklichung allein
kompositorischer Visionen eingesetzt wurde, das überraschte mich aufs
Eindringlichste und es ließ die Musikwelt aufhorchen; ein Komponist, der
zuvor nur in einem kleinen Insider-Kreis bekannt war, rückte damals
nachhaltig in das Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit.
Das Spektakuläre an den „Studies" ist ihr schier
unerschöpflicher Reichtum in der Erkundung polyphoner Zeitabläufe, der
Überlagerung unterschiedlicher Taktarten, der Gleichzeitigkeit verschiedener
Tempi, zahllose Formen komplexer Rhythmik. All diese Aspekte und damit die
‚übermenschlichen’ Fähigkeiten des Instrumentes werden von Nancarrow bis ins
Detail untersucht. Daß das klingende Ergebnis aber alles andere als nach
trockener Gehirnakrobatik oder nach Papiermusik klingt, sondern daß analog
zum Reichtum rhythmischer und zeitlicher Organisation der musikalischen
Texturen ein ebenso großer Reichtum emotionaler Facetten gegeben ist, das
zeichnet das Lebenswerk aus, das Nancarrow mit seinen gut 50 „Studies"
der Nachwelt hinterlassen hat.
Sicherlich sind es vor
allem die polyphonen Aspekte dieser Musik, die aufregend neu sind, im
wahrsten Sinne des Wortes ‚unerhört’. Es war - so glaube ich - György Ligeti,
der erstmals die „Studies" von Nancarrow als „eine Art wohltemperiertes
Klavier des 20. Jahrhunderts" wertete, eine Einschätzung, die
mittlerweile viele teilen! In diesem Vergleich zu Bachs großem Klavierwerk spiegelt
sich vornehmlich die Erkenntnis, daß Nancarrow ähnlich umfassend und geradezu
exemplarisch auf ein Instrument beschränkt ein einmaliges und
unvergleichliches Universum polyphonen Denkens entworfen hat.
So behandeln auch die
ersten Analytiker der „Studies", bei denen wohl an erster Stelle der
amerikanische Komponist James Tenney [1] genannt werden muß, im Wesentlichen die diversen
polyphonen Strategien Nancarrows, und Tenney stellt zu Recht fest, daß schon in
der Study No.1 „viele der für Nancarrows Musik charakteristischen Prozesse:
das Neben- und Übereinander verschiedener Metren und Tempi" [2]
zu finden sind.
Auch mein persönliches
Ohrenmerk richtete sich naturgemäß zunächst nur auf dieses eben
‚ohrenfällige’ Phänomen. Und als ich 1999/2000 dem hartnäckigen Drängen von
Jürgen Hocker [3], der in den Konzerten der Kölner Triennale 2000
ganz neue Stücke für Player-Piano [4] neben Nancarrows Musik präsentieren wollte,
nachgab und selbst erstmals das Player-Piano kompositorisch nutzte, spielten
dabei für mich zwar auch kontrapunktische Aspekte des zeitlichen Verlaufes
eine Rolle - der auf Bach verweisende Titel „Inventionen" deutet es an
-, aber im Zentrum meines Interesses standen harmonische Fragen (jede der
drei „Inventionen" hat ein eigenes in sich geschlossenes harmonisches
Gesicht [5]). Nur durch diese Gewichtung war es mir gelungen,
meine Bedenken zu überwinden, nach Nancarrow selber einmal das
selbstspielende Klavier kompositorisch einzusetzen, schien mir doch das
Universum seiner „Studies" nahezu alle Möglichkeiten durchmessen zu
haben.
Daß aber neben der
ungemein ausgefeilten Organisation der zeitlichen Abläufe auch die
Organisation der Töne bei Nancarrow nicht allein intuitiv gelöst ist, sondern
oftmals in hohem Maße strukturiert ist und damit jede einzelne „Study“ ihre
ganz eigene harmonische Physiognomie hat, das bemerkte ich erst später beim
genaueren Studium der Noten.
Bei der eingehenderen
Analyse einiger „Studies" (es ist mir ein äußerst anregender
Zeitvertreib und intellektueller Lustgewinn geworden) habe ich kürzlich Entdeckungen
gemacht, die in den mir bisher zugänglichen Schriften über Nancarrow
weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Von einigen dieser Entdeckungen soll
nun im Folgenden die Rede sein. Ich werde zudem ein paar Seitenblicke auf
György Ligeti werfen, in dessen Klavieretüden deutliche, auch von ihm selbst
eingestandene Spuren [6] von Nancarrows Musik zu finden sind.
II (Exposition)
Ende der vierziger Jahre
begann die fast ausschließliche Arbeit Nancarrows für das Selbstspielklavier
mit der eben schon erwähnten „Study No. 1“. Es war nicht allein der
‚objektive’ Klangcharakter des mechanischen Klaviers, der Nancarrow angezogen
haben mag, sondern es war wohl vielmehr die leidvolle Erfahrung bei den
Aufführungen seiner früheren rein instrumentalen Werke, die wegen ihrer
rhythmischen Schwierigkeiten die ausführenden Musiker offensichtlich
schlichtweg überforderten, so daß ein „Septett“, das 1949, kurz vor
Nancarrows Übersiedlung nach Mexico, in New York gespielt wurde, trotz der
Beteiligung von Spitzen-Interpreten in einem „Desaster“, wie er es selber
empfand, endete.
In den ersten „Studies“
mit ihren Anklängen an Jazz, Blues, Ragtime und spanisches Kolorit vernimmt
man noch sehr deutlich die musikalische Herkunft Nancarrows, der als junger
Mann Jazz-Trompete spielte. Zwar werden beispielsweise in der schon fast
legendären Boogie-Woogie-Suite der „Studies No. 3a – 3e“ die Jazz-Modelle in
mehreren Schichten und metrisch unabhängig bis in aberwitzige Tempi getürmt,
so daß der Eindruck eines vieltonalen „Turbo-Boogie-Woogies“ entsteht, jede
Schicht ist für sich genommen aber in fast herkömmlicher und vertrauter
Jazz-Harmonik und -Gestik gehalten. Bemerkenswert an der formalen
Gesamtanlage der fünf Sätze ist ihre bogenförmige tonale Zentrierung: sie
stehen in den Tonarten C, F, C, G, C und erinnern somit an eine Kadenz:
Tonika – Subdominante – Tonika – Dominante – Tonika, die gleichzeitig das
sich ständig wiederholende funktionale Gerüst des ostinaten
Boogie-Woogie-Basses sowohl des eröffnenden ersten als auch des
abschließenden fünften Satzes der „Studies No. 3“ ist. Die harmonische
Kleinform wird also auf die Großform übertragen.
Fast alle der frühen
„Studies“ von Nancarrow kennzeichnet eine zwar freitonale, aber dennoch an
‚klassischem’ Dreiklangs-Denken orientierte harmonische Sprache. Die
Linienführung ist oftmals modal gehalten, und Dreiklänge – meist in enger
Lage – werden entweder wie eine Mixtur behandelt oder dienen der akustischen
Verstärkung von metrischen Schwerpunkten, sind also ebenfalls eher als
Farbwert, denn funktional gedacht. Typisches Merkmal der frühen „Studies“ ist
zudem die häufige Verwendung von Ostinati, ein kompositorisches Stilmittel,
das nach dem Ende der spätromantischen Tonalität in den 20er und 30er Jahren
nicht nur im Jazz, sondern auch bei Strawinsky, Hindemith und Bartók in
diversen Gestalten wieder auftauchte.
Eine verblüffende
Ähnlichkeit zu dieser Art Textur bei Nancarrow (ostinater Baß mit Allusionen
tonaler Funktionalität und darüberliegenden freien, jazz-ähnlichen
Figurationen) ist erstmals – wie ich finde – in Ligetis „Hungarian Rock“ für
Cembalo aus dem Jahre 1978 zu erkennen, hier natürlich trotz metrischen
Komplexitäten beschränkt auf das von Menschenhand noch Realisierbare. Zu
diesem Zeitpunkt (1978) wird Ligeti die Musik Nancarrows noch nicht gekannt
haben. Umso erstaunlicher ist diese Verwandtschaft, die aber natürlich die
spätere Begeisterung Ligetis für die „Studies“ erklärt.
Eine sehr eigenständige
und dennoch an Bartók und damit an die eigene geographischen Herkunft sich
anlehnende Art Ostinato finden wir auch im zweiten Satz des Horntrios von
Ligeti, jenem Stück, mit dem er die Musikwelt 1982 überraschte, war mit
diesem Stück doch der entscheidende Schritt weg von der für Ligeti zuvor so
typischen, clusterhaften Klangflächen-Technik geschehen. Eine Harmonik, die –
ähnlich wie bei Nancarrow – wieder eine Mischform aus Diatonik und Chromatik
ist, und eine elastische Poly-Rhythmik, die wieder metrische Schwerpunkte
fühlen läßt und nicht mehr in vielfacher Schichtung einen metrischen
‚Grauwert’ erzeugt, das sollte für Ligetis Klangsprache fortan und bis heute
prägend werden.
Lassen Sie mich, bevor ich
zu Nancarrow selbst zurückkehre, nun zunächst an einer der Klavieretüden
Ligetis beispielhaft die Nähe zu den schon angesprochenen Techniken
Nancarrows im Umgang mit Harmonik und den bei ihm latent gegenwärtigen
„verdeckten Spuren tonalen Denkens“, wie ich es nennen möchte, aufzeigen.
III
(Variation/Double)
Um es besonders plastisch
werden zu lassen, möchte ich mich besagter Klavieretüde auf einem kleinen
Umweg nähern. Hören Sie zunächst eine Folge von Akkordverbindungen:
Dies waren vier Phrasen
von jeweils vier Dur-Dreiklängen, die meist in einem dominantischen oder
mediantischen Verhältnis zueinander stehen; es folgten vier
Akkordverbindungen von Moll-Dreiklängen, wobei die letzte Folge nicht mehr
aus vier, sondern aus sechs Dreiklängen bestand. - Das klang nach einem
historisch schwer einortbaren Choralsatz, aber er hatte eine klare Perioden-,
bzw. Phrasen-Bildung.
Nun das Gleiche noch
einmal, allerdings ohne Tonverdopplungen. Durch geänderte Lagenverteilung
fällt der Grundton des jeweiligen Dreiklangs zudem nur noch selten in den
Baß; und ich spiele das Ganze metrisch nicht mehr in gleichmäßig schreitendem
Tempo. Aber wohl bemerkt: es handelt sich um die gleiche Dreiklangsfolge.
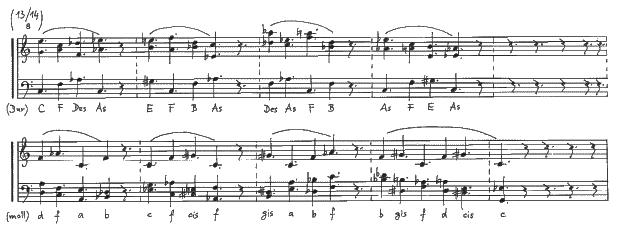
Kommt Ihnen das schon bekannter
vor? – Es fehlt in der Tat nur noch ganz wenig, und schon sind wir bei
Ligetis Étude Nr. 4 „Fanfares“ angekommen.
Wenn wir das Ostinato des
eben erwähnten zweiten Satzes des Horntrios nehmen, welches dort im Rhythmus
3 + 3 + 2 Achteln erscheint, und es lediglich in der Setzung der Schwerpunkte
zu 3 + 2 + 3 Achteln ändern und unter die eben gehörten Dreiklangsfolgen
legen, dabei die Notation teilweise enharmonisch verwechseln, so haben wir
exakt den Beginn der Étude Nr. 4:
Klangbeispiel:
Ligeti, Ètude 4
Nun geht das Alles
natürlich in einem bedeutend schnellerem Tempo, als ich es Ihnen soeben
vorführte. Es ist die rasante Geschwindigkeit, die das Ohr von dieser
harmonischen Gegebenheit ablenkt. Aber es ist eine sehr ähnliche Art der
Nutzung von (in diesem Fall) zunächst reinen Dreiklängen auf rhythmischen
Schwerpunkten, wie sie bei Nancarrow zu beobachten ist. Wie in einem schnell
sich drehenden Prisma springen diese reinen Dreiklänge bizarr hin und her und
addieren sich so zu einer Allgegenwärtigkeit verschiedener Tonalitäten. Es
ist ein äußerst raffinierter Kunstkniff, mit dem Ligeti hier geradezu
augenzwinkernd etwas Vertrautem eine ganz neue Gestalt gibt. Es ist aber noch
etwas Anderes, das ebenfalls an Nancarrow denken läßt, nämlich die
Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Metren, wie sie in vielen der Etüden zu
finden ist: während das Ostinato eine feste Periodenlänge von 8 Achteln hat,
schwanken die darüberliegenden Phrasen der ‚schrägen’ Hornquinten in einer
Länge von zunächst 13 oder 14 Achteln. Ich sollte vielleicht noch
erwähnen, daß das Ostinato metrisch zwar dreigeteilt, tonal aber gleichzeitig
nur zweigeteilt ist: den ersten vier Tönen der C-Dur Skala folgen die ersten
vier der Fis-Dur Skala. Also auch hier ist schon eine versteckte
Gleichzeitigkeit von Verschiedenem vorhanden.
Es wäre verführerisch,
jetzt noch den Prozeß der gleitenden Veränderungen bei der Harmonik der
Dreiklangsfolgen auf den metrischen Schwerpunkten des Ostinatos genauer zu
verfolgen, denn auf höchst spannende Art erweitert Ligeti die anfänglich
klare Ordnung (zunächst vier Phrasen Dur-Klänge, dann vier Phrasen
Moll-Klänge und dies gekoppelt mit einer Kreuzung der Stimmen beim tonalen
Geschlechtswechsel), indem die Phrasen der „Fanfaren-Motive“ teilweise
länger, zudem mit Septakkorden oder verminderten Dreiklängen angereichert
werden und sich schließlich in lineare Figurationen auflösen. Es ist ein
Prozeß zunehmender Komplexität.
Ich verzichte an dieser
Stelle auf eine weitergehende Analyse, erwähne es aber deshalb, weil
Ähnliches immer wieder bei Nancarrows „Studies“ zu beobachten ist, und dies
nicht nur bei den frühen: er beginnt mit einer Allusion tonaler und fast
funktionaler harmonischer wie melodischer Modelle, die sich dann in freierer,
aber davon abgeleiteter Gestalt weiterentwickeln.
IV
(Durchführung)
Aus den früheren
Ostinato-Studies Nancarrows ragt die No. 5 eindeutig heraus. Und sie ist
trotz ihres abstrakteren Stils, der schon auf die späteren „Studies“
verweist, ein beredtes Beispiel für Nancarrows Gespür für emotionale Wirkung!
(Beim ersten Hören dieser „Study“ mußte ich unwillkürlich an Ravels „Bolero“
denken.) Gleichzeitig zeigt sie auf verblüffende Art, wie bei ihm
funktionales, diatonisches und chromatisches Denken höchst raffiniert
verschränkt sind.
Diese „Study“ gehört zu
jenen, deren Verlauf einem stringenten Prozeß unterliegen, also einem
Höchstmaß an kompositorischer Planung unterworfen sind, wie es etwa auch beim
berühmten Canon X („Study No. 21“) der Fall ist, auf den ich später noch zu
sprechen komme. Und diese „Study“ spielt mit den Grenzen der
Wahrnehmungsschwelle.
In der No. 5 schichtet
Nancarrow zwölf (bzw. 13) harmonisch und rhythmisch unabhängige Ebenen, die
nach und nach einsetzen, und schafft in der Addition damit ein
beeindruckendes polytonales Klanggebäude. Zunächst setzen zwei ostinate
Ebenen gleichzeitig ein, die untere mit kraftvollen Baßschritten in Oktaven
wiederholt permanent eine C-Dur Kadenz, die zweite – ebenfalls in Oktaven
gesetzt – ist eine aufsteigende pentatonische Skala in H-Dur, mit Fis
einsetzend. Die Phasenlängen betragen 98 und 77 Sechzehntel, so daß im
Verlaufe der knapp drei Minuten, die das Stück dauert, der Beginn beider
Perioden trotz eines ungefähren Verhältnisses von 5:7 (was der Tritonus-Spannung
der Anfangstöne C und Fis entspricht) nie wieder zusammenfällt. Dennoch
empfindet man beide Schichten als zusammengehörig; daß es ein von Nancarrow
sogar selbst geliefertes Argument dafür gibt, beide Schichten als
„Resultante“ [7], wie Tenney es nennt, aufzufassen, davon später.
(Es ist übrigens ein
denkwürdiger Zufall, daß die beiden Initialtöne C und Fis auch exakt der
tonalen Zweiteilung des Ostinatos in Ligetis 4. Klavieretüde entsprechen!)
Auf dieses doppelte
Grund-Ostinato setzen nun nach und nach fünf weitere Schichten ein, jeweils
schnelle symmetrisch ab- und wieder aufsteigende Arpeggio-Arabesken. Die
erste Figur mit einer Länge von 11 Sechzehnteln steht in b-moll mit
phrygischer Sekunde, die zweite mit einer Länge von 7 Sechzehnteln klingt
nach einem alterierten Dominantseptakkord auf F, die dritte (13 Sechzehntel
lang) besteht aus einem G-Dur Dreiklang und einer viertönigen Ganztonskala
von E abwärts, die vierte ist eine diatonische Skala innerhalb eines
gedachten B-Dur Septakkordes mit einer Länge von 9 Sechzehntel und die fünfte
ist eine fast vollständige a-moll Tonleiter (wieder mit phrygischer Sekunde)
mit einer Länge von 15 Sechzehnteln. Bei diesen fünf Schichten werden die
Perioden ihrer Wiederholung durch Verkürzung der zwischenliegenden
Pausenwerte kontinuierlich verkürzt.
Nun folgen in der
zunehmenden Addition zwei gestisch sehr prägnante Schichten. Zunächst ein
fanfarenartiges Motiv mit sieben gleichmäßigen, trompetenhaften
Dreiklangsstößen, wobei die drei benutzten Dreiklänge F-Dur, A-Dur und As-Dur
in mediantischem Bezug zueinander stehen. Dieses Motiv erscheint alternierend
in zwei Gestalten, jeweils quasi gespiegelt. Es folgt eine aperiodische,
chromatisch fallende Figur im Quintrahmen der Töne F und C. Diese beiden
Schichten behalten ihre Einsatzabstände konstant bei; die Phasenlängen
betragen 51 (21{Dauer der Figur} + 30 {dazwischenliegender Pausenwert}) und
66 (35 + 31) Sechzehntel.
Auch die weiteren vier
Schichten, die nun noch hinzukommen, haben jeweils konstante Phasenlängen.
Zunächst im tiefen Register zwei sich abwechselnde Doppelquintklänge auf Des
und Ges (womit wieder einmal ein Tonika-Dominant-Verhältnis suggeriert wird),
deren Wiederholungsabstand 22 (11 + 11) Sechzehntel beträgt, dann im Diskant
die über die Oktave gespreizte Moll-Terz B – Des, die im Abstand von 17
Sechzehnteln erscheint. Es folgt, wieder im tiefsten Baß die Quinte H – Fis,
sie erklingt alle 13 Sechzehntel; und zuguterletzt kommt noch im
allerhöchsten Register der Dreiklang E-Fis-A mit einem
Wiederholungsabstand von 19 Sechzehnteln hinzu.
Jede der Schichten hat
also ihre eigene ganz tonale Zentrierung, in der sie konstant verharrt. Durch
die komplexen Verhältnisse der unterschiedlichen Phasenlängen der einzelnen
Schichten – sie entstehen durch die Bevorzugung ungerader Dauernwerte –
erscheint aber das stets Gleiche in immer wieder neuen Kombinationen und
durch die zunehmende Addition, bzw Accelleration der fünf Arpeggio-Schichten
entsteht gleitend eine Gesamt-Textur, die sich zu einer Art „weißem Rauschen“
verdichtet.
Das wirklich Geniale
dieser „Study“ ist ihre Tonhöhenorganisation! Jede der Schichten nutzt einen
beschränkten Tonvorrat (es sind der Reihe nach 15 + 11 / 6, 4, 7, 5, 8 / 7, 8
/ 6, 2, 2, und 3 Töne), und Nancarrow hat dies so strukturiert, daß jeder Ton
der gesamten Klaviatur genutzt, dabei aber nur jeweils in einer Schicht
verwendet wird – es fehlen lediglich die beiden tiefsten und drei höchsten
Töne, die beim Player-Piano nicht spielbar sind, da diese Tonspuren der
Papierrolle für die Steuerung der Dynamik und des Pedals belegt sind. Es
erklingen also tatsächlich am Ende alle 83 möglichen Töne quasi gleichzeitig
als chromatische Totale [8].
Einzige Ausnahme ist das H unterhalb des mittleren C, das sowohl als Leitton
in der ostinaten C-Dur Kadenz und in der pentatonischen Skala als Grundton
vorkommt, so daß mit dieser Verknüpfung praktisch eine „komponierte“
Legitimation gegeben ist, diese beiden Ostinato-Schichten, wie oben schon
angedeutet, als eine Einheit aufzufassen.
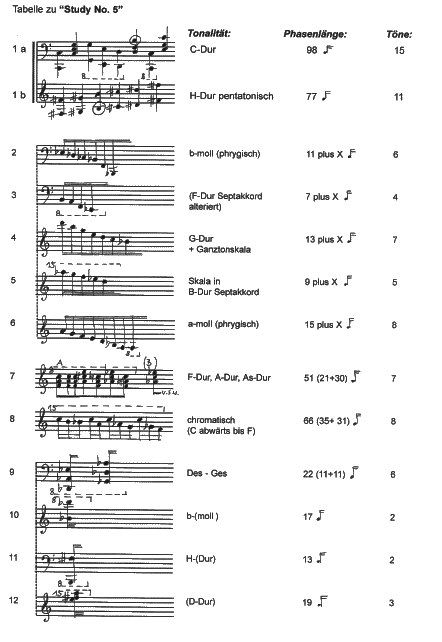
V (Intermezzo)
Reine Dur-Dreiklänge in
enger Lage und jazz-ähnliche Texturen tauchen, nachdem Nancarrow in den
mittleren „Studies“ oftmals Sept- oder Nonenakkorde, sowie noch komplexere
Misch-Akkorde und ohnehin abstraktere musikalische Aggregat-Zustände
verwendet, wieder in den letzteren „Studies“ auf, etwa in den No.
41a–c. Hier werden sie allerdings eigentlich ausschließlich wie Mixturklänge
eingesetzt, und versteckt funktionales Denken verschwindet hier zugunsten
eines fast improvisatorischen Tonfalls. Ein gestisch freies Parlando mit
zahllosen rasanten Glissando-Einwürfen kennzeichnet diese „Studies“.
Aber ich möchte noch eine
kleine Auswahl an Beispielen bringen, bei denen die Schatten des „verdeckt
tonalen und funktionalen Denkens“ auch dort zu spüren sind, wo es auf den
ersten Blick (oder beim ersten Hören) nicht so offensichtlich ist, wie bei
den zuvor erläuterten Fällen. Dabei möchte ich die rhythmisch-metrischen
Aspekte einmal ausklammern, so faszinierend diese auch jeweils sind.
Die fünftönigen
Staccato-Akkorde, die als Wiederholungssequenz einer 15 Werte umfassenden
Dauernserie die „Study No. 11 eröffnen, haben als unterstes konstitutives
Binnen-Intervall durchwegs die Quinte, und die ersten fünf Klänge lassen sich
eindeutig als eine Kadenzbildung T – tG – S – D – T in C-Dur lesen. Auch der
weitere modulatorische Verlauf ließe sich funktional erklären, er mündet in
einer Art Schlusswendung (S – D) zur ersten Wiederholung dieser Dauernserie,
die nun mit einem F7-Akkord (also subdominantisch zum anfänglichen
C7-Dur) beginnt. Während die Dauernserie unverändert 16mal im
ersten Abschnitt des Stückes erscheint, wird der Kreis der pseudo-tonalen
Funktionen permanent leicht variiert.
Auch in der „Study No. 14“
(Canon – 4/5) bestimmt die Quinte das harmonische Geschehen, sie ist nämlich
die Distanz der beiden metrisch zwar selbständigen, aber vom Text identischen
Schichten: die untere langsamere, aus zwei Linien bestehende Schicht steht in
der Tonalität E, die später einsetzende hohe steht in einer H-Tonalität.
Dies erinnert eindeutig an
die Dux- und Comes-Situation der alten Fugentechnik.
Bei der „Study No. 18“
(Canon – 3/4) findet man zu Beginn die Allusion einer Quintfall-Sequenz
ausgehend von A-Dur.
Auf eine äußerst spannende
und ungewöhnliche Art nutzt Nancarrow den reinen Dur- (bzw. Moll-) Dreiklang
in der „Study No. 24“ (Canon – 14/15/16). Die drei Stimmen dieses Canons
stehen in einem jeweils über die Oktaven gespreizten Dreiklangs-Abstand. Sie beginnen
gleichzeitig, bedingt aber durch die ganz nah beieinander liegenden
Temporelationen der drei Stimmen zueinander entstehen aufregende
Interferrenzen des zeitlichen Ablaufes: der anfänglich vertikale
Dreiklangs-Abstand der Stimmen verrutscht also immer mehr in horizontale
Richtung. In der Mitte des ersten Abschnittes kehrt sich dieser Prozeß wieder
um, indem die beiden äußeren Stimmen ihre Temporelationen (16/14)
austauschen, während die mittlere in ihrer (15) verharrt. Damit nähert sich
der ‚virtuelle’ Dreiklang im Abstand der drei Stimmen wieder, bis er am Ende
im vertikalen Zusammenklang wieder übereinandersteht. Dieses Prinzip
gradueller Phasenverschiebung bleibt konstitutiv für das ganze Stück.
Aber nicht nur der Abstand
der drei Stimmen ist „tonal“, sondern auch jede Linie für sich umspielt
permanent tonale Zentren. Die oberste beginnt in A-Dur und führt gleich
weiter zur Dominante E, die mittlere startet dementsprechend in Fis-Dur, die
untere in D-Dur.
Beim zweiten Abschnitt des
Stückes, der im Kontrast zur weichen Melodieführung des ersten von kurzen
prägnanten Staccato-Motiven geprägt ist, ist nun der Abstand der drei Stimmen
ein gespreizter Moll-Dreiklang. Er beginnt mit h-moll, was die Moll-Parallele
zum D-Dur am Beginn des Stückes ist. Auch dieses harmonische
Beziehungsverhältnis zweier kontrastierender musikalischer Gedanken kennen
wir aus der Tradition!
Und noch ein Beispiel für
die denkwürdigen unterirdischen Bezugslinien zur Tradition tonalen Denkens.
Beim geradezu enigmatischen Canon 1/1 („Study No. 26“), bei dem die insgesamt
sieben, immer in Oktaven und gleichförmig in ganzen Notenwerten schreitenden
Stimmen mit einer fünftönigen Sequenz beginnen, ist – wie ich finde – eine
verblüffende Ähnlichkeit zu den ersten fünf Tönen des Themas aus dem
„Musikalischen Opfer“ von Bach gegeben. Nancarrow beginnt mit dem Leitton H
zum abwärts gerichteten C-Dur Dreiklang, dem der Mollterzton Es folgt; dies
klingt wirklich fast wie Bach rückwärts! Auch die weitere Linienführung läßt
Verwandtschaften erkennen: die bei Bach fallende chromatische Linie im
Quintrahmen des Ausgangsdreiklangs wird bei Nancarrow zu einer schnabelförmig
sich schließenden, chromatischen Ausfüllung des binnenliegenden Tonraumes.
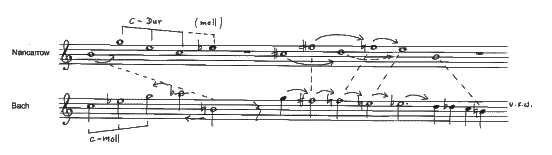
Man kann nur darüber
spekulieren, ob Nancarrow hier bewußt seiner Musik einen heimlichen Verweis
auf Bach eingeschrieben hat. Es wäre nicht verwunderlich, bekannte Nancarrow
doch, daß die wesentlichen Einflüsse bei ihm „die Musik Strawinskys und
bis zu einem gewissen Grade diejenige Bartóks und natürlich die Musik Bachs
gewesen sind.“ [9]
VI (Reprise & Coda)
Eine „heimliche
Botschaft“, die äußerst raffiniert versteckt wurde, glaube ich, im wohl
berühmtesten Stück von Nancarrow, dem Canon X („Study No. 21“), gefunden zu
haben. Davon nun zum Schluß.
Der Canon X gehört wie die
„Study No. 5“ zu jenen Stücken, denen ein ausgeklügelter, strenger formaler
Bauplan zugrunde liegt. Und trotz aller Strenge ist dieses außergewöhnliche
Stück alles Andere als akademisch, so simpel die eigentliche kompositorische
Idee zunächst erscheint. Das „X“ verweist symbolisch auf die gegenläufige
Temporelation der beiden Stimmen: die eine im Baß beginnt in relativ
langsamem Tempo, die andere wenig später im Diskant einsetzende beginnt in
einem sehr schnellen Tempo. Im Verlauf des Stückes beschleunigt sich die eine
Stimme permanent, während sich im Gegenzug die andere kontinuierlich
verlangsamt, so daß sich beide Stimmen in der Mitte bei einem mittleren Tempo
wie ein „X“ kreuzen. Nun ist das Stück aber eben nicht streng symmetrisch
gebaut, sondern hat eine dynamische Komponente, die aus verschiedenen
Faktoren gespeist ist. Zum einen beginnen nicht beide Stimmen gleichzeitig,
aber sie hören gleichzeitig auf! Zum andren klaffen die Proportionen zu
Beginn und am Ende weit auseinander: am Anfang ist das Verhältnis beider
Stimmen zueinander 1 : 11 (bei etwa 3,5 Tönen pro Sekunde bei der langsamen
Stimme), am Ende haben wir ein Verhältnis von 98 : 1 (wobei sich die
beschleunigende Stimme nun auf schier unglaubliche 111 Töne pro Sekunde
gesteigert hat, während die andere sich auf etwa 2,3 Tönen pro Sekunde
verlangsamt hat).
Zudem gibt es noch eine
Art „Stringendo“ im Tonmaterial, denn neben der Strukturierung der
Tempobeziehungen ist auch die Organisation der Tonhöhen sorgfältigst geplant:
beide Stimmen basieren auf einer Reihe von zunächst 54 Tönen. Bei jedem
weiteren Durchgang fällt der jeweilige Anfangston der sich somit stetig
verkürzenden Reihe fort, so daß von dieser Reihe schließlich nur noch ein Ton
(der letzte) übrig bleibt. Beim Tonmaterial beider Stimmen gibt es also keine
Gegenläufigkeit: die andere kehrt diesen Prozeß der sukzessiven Verkürzung
nicht um!
Nun ist das Stück aber
nicht an dem Punkt zu Ende, wo sich beide Stimmen (sozusagen in der Phase)
bei diesem letzten Ton der Reihe treffen – an diesem Punkt haben sie nur ihr
gegenseitiges Tempoverhältnis vom Anfang (1 : 11) im Austausch wieder
erreicht - : hier beginnt nun eine Art „Reprise“, „Coda“ oder „Stretta“,
indem die inzwischen langsamere Stimme in mittlerweile fünffachen Oktaven [10] noch einmal die komplette Reihe spielt und zu den
54 Tönen am Ende sogar noch einen 55. Ton hinzufügt, während die inzwischen
schnelle Stimme noch einmal den kompletten bisherigen Zyklus (54 + 53 + 52
... 3 + 2 + 1) in sich weiter steigerndem Tempo durchläuft, und am Ende
ebenfalls im Einklang mit der anderen Stimme den 55. Ton C anhängt [11].
Wenn man diese
54-Ton-Reihe einmal genauer untersucht, stellt man fest, daß sie enorm viele
tonale und funktionale Momente hat. Sie beginnt mit einer fast klassischen
dominantischen Wendung zu f-moll und nach einer Moll-Subdominante erscheint
sofort der Geschlechtswechsel zu F-Dur. Über die Zwischendominante E-Dur
moduliert sie weiter zu A-Dur, usw.
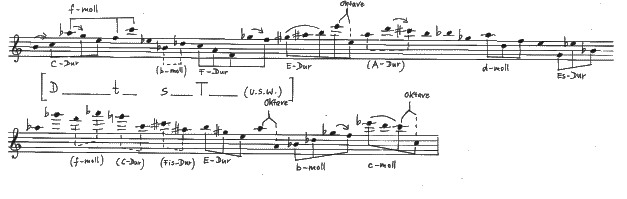
Diese Tonreihe ist wegen
ihrer latent tonal-funktionalen Gestalt schon aufregend!, zeigt sie doch ein
erneutes Mal, daß Nancarrow höchst eigenwillig tonale Denkstrukturen mit
komplexen Strategien der Zeitplanung verbindet, ohne daß damit ein
Widerspruch im Gesamtkontext entsteht, ja vielleicht sogar diese scheinbar
rückwärts gerichtete tonale Strategie notwendig ist als Gegengewicht zur
Komplexität der metrischen Organisation.
Vielleicht noch
aufregender ist aber die versteckte, nicht wahrnehmbare Tonreihe dieser
„Study No. 21, die sich nur über die genaueste Analyse erschließt! Nancarrow erwähnt
sie eher beiläufig in der eigenen Beschreibung dieser „Study“ [12], und er bleibt dabei recht ungenau, verschweigt
sogar das Wesentliche! Und niemand scheint sie sich bisher einmal genau
angeschaut zu haben.
Diese Reihe (es ist die
Reihe, die sich ergibt, wenn man die Transpositionen der Ausgangsreihe bei
ihren jeweiligen Wiederholungen notiert) hat nämlich auf geradezu
atemberaubende Weise eine dynamische Komponente der ganz besonderen Art!
Diese Transpositionsreihe
– man erhält sie, wenn man den jeweils letzten Ton notiert (denn nur dieser
bleibt ja nach dem 54. Durchlauf am Ende übrig) – beginnt zwar zunächst, wie
Nancarrow selber sagt, als streng dodekaphonische Reihe, doch ließt man den
weiteren Fortgang genau, so ergibt sich ein ganz verblüffendes Phänomen!:
geradezu fließend findet ein Prozeß statt, der von einer an Webern
erinnernden Reihen-Technik mit ihren chromatischen Sequenz- und
Spiegelbildungen [13] ausgeht, der sich aber über zunehmende
Abweichungen vom seriellen Denken – in der Mitte dieser Reihe hat sich die
Chromatik schon zu einer ganztönigen (bzw. übermäßigen Dreiklangs-) Tonalität
aufgeweicht – nach und nach zu einer ganz schlichten diatonischen Schlußkadenz
wandelt.
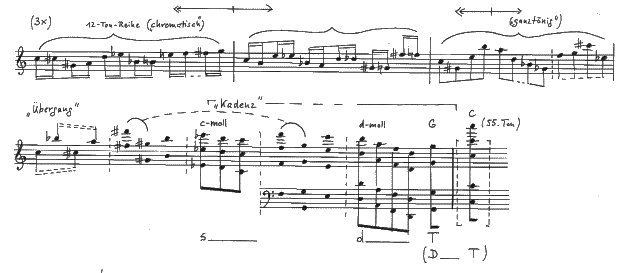
Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang ist zudem, daß Nancarrow auch die eigentliche Reihe bei ihrem
letzten 55-tönigen Durchlauf in fünffachen Oktaven nach dem 50. Ton umbiegt
zugunsten einer klaren Dominant-Tonika-Wendung, die zum Schlußton C führt.
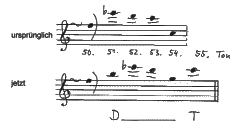
Dies alles ist alles
Andere als ein Zufall!
Bedenkt man die ungefähre
Entstehungszeit des Canon X (Mitte der 60er Jahre, also die Zeit der
„Hochblüte“ seriellen Denkens bei den europäischen Komponisten), so ist man
sogar fast geneigt, zu vermuten, Nancarrow, der damals noch in völliger
Isolation lebte, habe mit dieser versteckten Reihe eine heimliche Botschaft
als ‚Flaschenpost’ an die ihn ignorierenden Komponisten-Kollegen gesandt: verlaßt
das serielle Denken, kehrt zurück zur Tonalität!
Natürlich weiß ich, dies
ist eine zwar verführerische, aber dennoch äußerst spekulative und ziemlich
unwahrscheinliche Hypothese. Davon, daß diese ganz besondere, heimlich dem
Canon X eingeschriebene Reihe aber dennoch für Nancarrow selbst
bekenntnishaften Charakter bezüglich seiner eigenen Einstellung zur Tradition
hat, davon bin ich zutiefst überzeugt!
Und ich darf zur
Bestätigung meiner Überzeugung noch einmal eine andere ganz besondere Reihe
in Erinnerung rufen, die 12-Ton-Reihe des „Violinkonzertes“ von Alban Berg.
Auch sie hat bekenntnishaften Charakter. Ihr Prinzip, Zwölftondenken mit
traditionellem Dreiklangsdenken zu verschmelzen ist nirgendwo sonst bei ihm
so extrem ausgeprägt. Die Terzschichtung aus g-moll, D-Dur, a-moll, E-Dur,
also Dreiklängen auf den leeren Saiten der in Quinten gestimmten Geige, und
die sich zum Schluß öffnende Ganzton-Folge sind ebenso wie bei Nancarrows
Reihe ein Zeugnis für die tiefe Verwurzelung des Komponisten in der
Tradition und gleichzeitig trotz dieser Bindung an Vergangenes eine
„komponierte“ Option in die Zukunft.
Hören wir nun abschließend
den immer wieder faszinierenden Canon X, dessen kompositorische Anlage fast
bildlich den Punkt ausmacht, wo Vergangenes und Zukünftiges sich im Moment
der Gegenwart treffen.
© 2001
Michael Denhoff
|