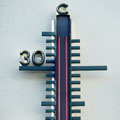|
||
|
https://www.instagram.com/beethoven_los/
Neujahrsgeläut | Abgehängt, aufbewahrt | Celesta | Hinter Gittern | Dialog Im Wasser | Eingang | Secco | Erstinstrument | Mangold Jacken-los | Applaus-los | Handschutz | Ronaco | Sperrzone Oster-Kurzzeitarbeitsloser | Lehrstand | Luftig | Blattweiß | Einblick Erleuchtet | Trompeteria | Häuslich | Oval | Verbindungen Entwachsen | Nebenstelle | Vergoldet | Oberleitung | Roll-Tiere Anstiegs-Stopp | Linsenauge | Longtime | Entschlüpft | Motiv Mal-Material | Erklungen | Nachdenken | Scheurebe | Couple Hochspannung | Unterhaltung | Nachlesen | Durchleuchtet | Flaggen RegenRose | Eingewachsen | Interieur | Sichtweise | Exterieur Integriert | Natale | ¡ _ _ _ !
N Neunte - zum Jahreswechsel von tausenden von Japanern zelebriert, fast schon eine Krankheit. Die Japaner selbst haben sie erkannt und benannt: Daikubyo. (KW 1)
A Aktien - kaufte B. im Juli 1819 bei der noch jungen österreichischen Nationalbank und war damit einer der ersten, der in diese neue Anlageform investierte. Er bewahrte die Aktien für die Zukunft seines Neffen auf. (KW 2) C Credo - steht auf Beethovens Wunsch vor der Notenzeile des Heftes, das er auf dem bekannten Portrait (mit dem roten Schal) in der Hand hält. Mit dem Glauben an (eine) Gott(heit) - im Christentum wie auch in anderen Religionen - hat sich Beethoven viel auseinandergesetzt. (KW 3) H_ Humor - hatte Beethoven mehr als man ihm zutraut. Das hört man an vielen Stellen in seiner Musik und liest in Briefen an gute Freunde, z.B. an den "nicht Musik-Graf sondern Freßgraf Dineengraf Soupeengraf etc." Nikolaus Zmeskall oder an das "höllische Lumpenkerlchen", den Verleger Tobias Haslinger. (KW 4) D Dialekt - habe Beethoven gesprochen, und in einer "etwas gewöhnlichen Ausdrucksweise", berichtete eine Wiener Dame. Und der aus Bonn stammende Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné erzählte von Beethovens an ihn gerichteten Worten: "Dich verstehe ich, du sprichst Bönnsch". (KW 5) I Ichtyophage - wurde Beethoven einmal von einem Freund genannt. Das bedeutet "Fischesser", denn Beethoven aß sehr gerne Fisch, besonders Karpfen und Hecht. Regelmäßig ließ er sich zum Beispiel von der Fischhändlerin Therese Jonas beliefern. (KW 6) E eng - hatte es die Familie Beethoven an ihrer ersten Adresse in Bonn, dem Geburtshaus, nicht. Den Eltern und ihrem kleinen Ludwig standen im gartenseitigen Haus in der Bonngasse immerhin drei Etagen mit Küche, Wirtschaftsraum (Erdgeschoss), drei Zimmern (erste Etage) und Schlafkammern unterm Dach zur Verfügung. Als Ludwig drei Jahre alt war, zog die kleine Familie von der Bonngasse weg. (KW 7) S Schampus - hat auch Beethoven gelegentlich gerne in Gesellschaft getrunken, zum Beispiel am 2. September 1825 bei einer feucht-fröhlichen Zusammenkunft mit guten Freunden in Baden. Man schrieb sich Notenrätsel und Kanons, spielte mit Worten und trank reichlich Champagner, der Beethoven - so schrieb er in einem Brief am Folgetag - "sehr zu Kopf gestiegen" war, so dass er "abermals die Erfahrung machen mußte, dass d.g. meine Wirkungskräfte eher unterdrücken als befördern". (KW 8) E Elf - Jahre alt war Beethoven, als erstmals eine Musik von ihm gedruckt wurde: die Dressler-Variationen WoO 63. Mozart war beim Erscheinen seiner ersten gedruckten Noten acht Jahre alt. Wunderkind hin oder her: beide sind großartige Musiker geworden - das gelingt nicht jedem Wunderkind. (KW 9) M_ Makkaroni - mit Parmesan soll in Wien Beethovens Lieblingsgericht gewesen sein, berichtet Anton Schindler. Makkaroni (seinerzeit eher ein Oberbegriff, nach Goethe ein "in gewisse Gestalten gepreßter Teig") und Parmesan waren damals teuer, denn sie mussten aus Italien importiert werden. In Beethovens Gesprächsheften werden Makkaroni und Parmesan - anders als andere Speisen - nur wenige Male notiert. Sie waren eben etwas Besonderes... (KW 10) J Jabot - und Perücke trug Beethoven als Musiker der Bonner Hofkapelle, dazu einen seegrünen Frack. In Wien, wo er sich viel im adeligen Umfeld bewegte, lässt er sich zunächst (1802) modisch elegant und mit Kurzhaar-Frisur von dem dänischen Maler Christian Horneman porträtieren. Komponierend, in legerer Kleidung - Morgenrock, mit locker gebundenem roten Tuch - und mit etwas längeren lockigen Haaren wird Beethoven dann 1820 als "inspirierte Persönlichkeit in seiner eigenen Welt" von Joseph Stieler in Szene gesetzt. In beiden Darstellungen gefiel sich Beethoven gut. (KW 11) A Akademien – hießen die öffentlichen Konzerte damals, die von Musikern selbst organisiert und finanziert wurden. Beethoven hat einige solcher Akademien veranstaltet, in denen seine Sinfonien und andere Werle (ur-)aufgeführt wurden. Sie dauerten meistens mehrere Stunden. Nicht immer blieb am Ende für Beethoven ein Gewinn übrig, und manchmal spendete er den Gewinn einem wohltätigen Zweck. (KW 12) H heilen - konnten Beethovens Ärzte den an verschiedenen Krankheiten leidenden Patienten letztlich nicht. 1821 wurde bei Beethoven eine Gelbsucht diagnostiziert. Seitdem war seine Leber geschädigt und mit dem Abbau von Alkohol und Blei - damals u.a. in medizinischen Salben, Pflastern, Wasserrohren und Weinzucker - überfordert. So entwickelte sich bei Beethoven eine Leberzirrhose, die schließlich am 26. März 1827 zum Tod führte. (KW 13) R_ Rückzug - aus dem öffentlichen Leben hatte Beethoven wegen seiner zunehmenden Ertaubung erwogen. Für ein halbes Jahr auf dem Land als Bauer leben, "vielleicht wird's dadurch geändert", schrieb er im Juni 1801 an seinen Bonner Jugendfreund, den Arzt Franz Gerhard Wegeler. Aber diese Art der Resignation war Beethovens Sache nicht. Schon wenige Monate später schreibt er erneut an Wegeler: "ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht." (KW 14) S So - klopft das Schicksal an die Tür, soll Beethoven zum Anfang seiner 5. Sinfonie, dem bekannten tatatataaa, gesagt haben. Dabei war es Beethovens Biograf Anton Schindler, der diese Musik so empfand, als sei es der Kampf eines Helden mit dem Schicksal. Das hat Schindler dann später dem Komponisten in den Mund gelegt, weshalb die Fünfte zu Unrecht "Schicksalssinfonie" genannt wurde. (KW 15) O Ohne – eine feste Anstellung hatte Beethoven sich sein Leben eigentlich nicht vorgestellt. Wie sein Vater und sein Großvater, strebte auch er eine Festanstellung an einem Hof an. Immer wieder hoffte er darauf. Noch 1822 bewarb er sich in Wien um die Stelle des k.k. Hofkomponisten. Weil daraus aber nie etwas wurde, musste Beethoven als freischaffender Musiker auskommen, was ihm auch sehr gut gelang. Übrigens hatte sich Mozart bereits 1781 aus den Diensten des Erzbischofs Colloredo in Salzburg befreit und lebte seitdem als freischaffender Künstler in Wien. (KW 16) L Lernen – wollte Beethoven sein Leben lang. In der Schule war er nur wenige Jahre – wie die meisten Kinder damals, die bald in die beruflichen Fußstapfen ihrer Väter traten, denn eine Schulpflicht gab es damals nicht. Das hat sich vor allem auf Beethovens geringe Rechenkünste ausgewirkt. Aber Beethoven war immer neugierig, hat viel gelesen und sich so selbst weitergebildet. (KW 17) L_ Lange – hat es Beethoven nicht ausgehalten mit dem nassen Gips auf dem eingeölten Gesicht, den Röhrchen in den Nasenlöchern, den Kopf nach hinten gebeugt. Er glaubte, keine Luft mehr zu bekommen, und riss sich den Gips vom Gesicht. Erst beim zweiten Versuch gelang die Gipsmaske, nach der Franz Klein dann eine Büste des 41-jährigen Komponisten gestaltet hat. Kein Wunder, dass diese Büste ihn mit einem missmutigen Gesichtsausdruck zeigt. (KW 18) B Bonaparte – wollte Beethoven seine dritte Sinfonie betiteln. Als er erfuhr, dass Napoleon zum Kaiser proklamiert wurde, soll er das Titelblatt durchgerissen und auf die Erde geworfen haben. Die Originalhandschrift existiert nicht mehr, aber eine Abschrift der Sinfonie mit Eintragungen von Beethoven. Auf deren Titelblatt wurde „intitulata Bonaparte“ so heftig ausrasiert, dass Löcher entstanden. Auf dem gedruckten Titel stand dann „Sinfonia eroica … composta per celebrare la morte d’un Eroe“ bzw. „per festeggiare il sovvenire di un grand’uomo“ – wer auch immer damit gemeint war. (KW 19) E Eingeschrieben – hatte sich Beethoven am 14. Mai 1789 in die Matrikel der philosophischen Fakultät der „Hohen Schule in Bonn“. Damit wollte er in den zweijährigen „Cursus“ eintreten. Dieser entsprach der heutigen Sekundarstufe II bzw. der gymnasialen Oberstufe. Beethovens musikalische Verpflichtungen werden ihm aber kaum Zeit gelassen haben, regelmäßig Vorlesungen zu besuchen – vermutlich aber doch einige des freigeistigen Franziskanerpaters Eulogius Schneider. (KW 20) E Erzherzog – Rudolph, Enkel Maria Theresias, jüngster Bruder von Kaiser Franz, Erzbischof von Olmütz, war ein großer Förderer Beethovens und sein einziger Kompositionsschüler. Oft genug hatte Beethoven den Unterricht ausfallen lassen. Seinem „erhabenen Schüler“ widmete er aber so viele Werke wie keinem anderen, darunter die Missa solemnis für dessen Inthronisation als Erzbischof - die drei Jahre nach diesem Ereignis fertig wurde. (KW 21) T Taub – wurde Beethoven bekanntlich im Laufe seines Lebens, zumindest so gut wie. Hörrohre halfen ihm nur kurze Zeit. Vielleicht haben sie sogar eher geschadet, seinem rechten Ohr zumindest, meinte er selbst. Auf dem linken muss er bis zuletzt noch ein geringes restliches Hörvermögen gehabt haben. Als er in seinen letzten Lebensjahren den Schrei eines Kindes wahrnahm, machte ihn das so glücklich, dass er hell und freudig aufgelacht haben soll. (KW 22) H Heiraten – bringt ein wenig Freude aber dann eine Kette von Leiden, meinte Beethovens Mutter. Beethoven selbst hätte schon gerne geheiratet. Verliebt war er oft genug, und einmal hätte er den nächsten Schritt gerne getan und hat sich dafür sogar seinen Taufschein aus Bonn kommen lassen. Aber wie immer war es auch in diesem Fall der Standesunterschied, der den Plan scheitern ließ. (KW 23) O Oberhofkoch – beim Trierer Kurfürsten in Ehrenbreitstein war Johann Heinrich Keverich, der Vater von Beethovens Mutter Maria Magdalena. Mit erst 16 Jahren heiratete Maria Magdalena zum ersten Mal und wurde zwei Jahre später Witwe. Den Hofmusiker Johann van Beethoven heiratete sie dann mit knapp 21 Jahren und bekam mit ihm sieben Kinder, von denen vier im Kindesalter starben. Beethovens Mutter wird als häusliche Frau beschrieben, deren Augen stets ernsthaft blickten. Für Beethoven war sie „eine so gute, liebenswürdige Mutter, meine beste Freundin“. (KW 24) V Vater - Johann van Beethoven hat als Musiker und geachteter Lehrer das Talent seines Sohnes Ludwig früh erkannt und gefördert. Johann konnte durchaus streng sein, was in der Erziehung der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich war. Wenn Johann Wein getrunken hatte, was er gerne tat, war er „munter und fröhlich“, nie boshaft oder aufbrausend. Nach dem Tod seiner Frau 1787 hat er sich dann aber gehen lassen, so dass sein Sohn Ludwig die Verantwortung als Familienoberhaupt übernehmen musste. Von seinen Eltern hat Ludwig van Beethoven immer mit viel Liebe und Achtung gesprochen. (KW 25) E Erziehungsverantwortung – für seine beiden jüngeren Brüder hatte Beethoven schon früh übernehmen müssen. Nachdem er 1792 nach Wien gegangen war, folgten sie ihm bald nach: Kaspar Karl, der zunächst Musiker werden wollte und dann ins Bankgewerbe ging, und Nikolaus Johann, der Apotheker wurde. Zwar gab es aufgrund der sehr unterschiedlichen Naturelle immer wieder Konflikte. Oft aber unterstützten sich die Brüder gegenseitig (finanziell, mit Sekretärdiensten) und waren in Krisensituationen füreinander da. (KW 26) N_ Neffe – Karl, Sohn des Bruders Kaspar Karl, kam nach dem Tod seines Vaters mit neun Jahren in die Obhut seines Onkels Ludwig. Für Beethoven war Karl wie ein eigener Sohn, in den er viel projizierte. Für einen Heranwachsenden war dies sowie das ständige Gezerre mit dessen Mutter um das Sorgerecht eine Belastung. Das zeigt der Selbstmordversuch des knapp 20-jährigen, der wiederum für Beethoven ein großer emotionaler Schlag war. Karl ging später zum Militär, heiratete und wurde Vater von fünf Kindern. (KW 27) V Vöslauer – nicht Veltliner, war einer von Beethovens Lieblingsweinen. Die blaue Portugiesertraube soll Johann Graf von Fries in den 1770er Jahren aus Portugal mitgebracht und im Weingarten seines Schlosses in Bad Vöslau angepflanzt haben. (Der grüne Veltliner setzte sich erst nach Beethovens Tod in Österreich durch.) (KW 28) O Ortswechsel – durchziehen Beethovens Leben. Schon in Bonn zog die Familie einige Male um. In das Haus in der Rheingasse kehrte sie mehrfach wieder zurück. Gleiches gilt für das Pasqualati-Haus auf der Mölkerbastei, eine von über 20 Wiener Adressen. Grundsätzlich strebte Beethoven, wenn es die äußeren Umstände erlaubten, ein längeres Mietverhältnis an. Bei der oft zitierten großen Zahl von Umzügen werden kurzfristige Übergangsquartiere und Sommer-Adressen mitgezählt. Im größeren Radius war Beethoven kaum mobil. Gereist ist er relativ wenig. Vielleicht war er ja doch sesshafter, als man denkt. (KW 29) R_ Reitend – kann man sich Beethoven nicht vorstellen, aber offenbar konnte er reiten. Einmal soll er sogar ein Pferd geschenkt bekommen haben. Es wird berichtet, dass er es einige Male ritt und dann vergaß. Ein anderes Mal trug er sich mit dem Gedanken, sich ein Landgut und dazu ein Reit- und ein Zugpferd samt Kutsche zu kaufen. Daraus wurde aber nichts. (KW 30) A Adelig - war Beethoven nicht, denn das "van" war lediglich ein lokaler Namenszusatz seiner flämischen Vorfahren. Längere Zeit unternahm er aber nichts dagegen, dass man (z.B. das Wiener Landrecht) ihn für adelig hielt. Er selbst sah sich - im nach-revolutionären Verständnis - als qua Verdienst "geadelt" und somit mit dem Adel auf Augenhöhe. Beethoven ließ sich vom Wiener Hochadel unterstützen, umwarb ihn und bedankte sich mit gewidmeten Kompositionen. Oft zeigte er sich seinen Gönnern gegenüber aber auch ausgesprochen selbstbewusst oder spöttisch. (KW 31) L Lorgnon – nennt man eine Einglas-Sehhilfe mit Griff. Auch Beethoven besaß eine solche. Er war nämlich kurzsichtig. Eine Musik für Bratsche und Cello überschrieb er eigenhändig mit „Duett mit zwei obligaten Augengläsern“. Hierbei hat er sicher sich selbst den Bratschenpart zugedacht. In seinen letzten Bonner Jahren war er ja bekanntlich als Bratschist Mitglied des Hoforchesters. (KW 32) L Les Adieux – wird die Klaviersonate genannt, die Beethoven seinem Förderer und Schüler Erzherzog Rudolph widmete und in der er sich auf dessen Flucht vor den herannahenden Franzosen (Lebewohl) sowie die spätere Rückkehr nach Wien (Wiedersehen) bezieht. Beethoven hatte für die Sonate eigentlich den deutschen Titel „Das Lebewohl“ bevorzugt, denn „lebe wohl ist was ganz anders als les adieux, das erstere sagt man nur einem Herzlich allein, das andere einer ganzen Versammlung, ganzen städten.“ (KW 33) E Elise – erhielt am 27. April 1810 von Beethoven eine Bagatelle für Klavier geschenkt, die fast jeder kennt (zumindest den ersten Teil davon). Therese Malfatti, eine Klavierschülerin Beethovens, die er ernsthaft heiraten wollte, besaß das Notenblatt (warum?). Von dort kam es – wohl über Thereses Hausfreund und musikalischen Erben, den Pianisten Rudolph Schachner – an dessen Mutter Barbara Bredl. Bei dieser entdeckte es 1865 der Musikforscher Ludwig Nohl und brachte es ans Licht der Welt. Und wo bzw. wer ist da Elise? Das wird Beethovens Geheimnis bleiben. (KW 34) M_ Mondschein – auf einem ruhigen See hat sich Ludwig Rellstab beim Hören des ersten Satzes von Beethovens cis-Moll-Sonate vorgestellt. Das war wenige Jahre vor Beethovens Tod. Erst einige Jahre nach seinem Tod wurde die Sonate unter dem Beinamen „Mondscheinsonate“ geführt, natürlich ohne Wissen geschweige denn Einverständnis des Komponisten. Das Stück war offenbar auch ohne Beinamen schon zu Lebzeiten des Komponisten so beliebt, dass er sich fast darüber ärgerte: „Immer spricht man von der Cis-mol Sonate! Ich habe doch wahrhaftig Besseres geschrieben.“ (KW 35) M Mozart – war für Beethoven ein großes Vorbild. „Allzeit habe ich mich zu den größten Verehrern Mozarts gerechnet, und werde es bis zum letzten Lebenshauch“, bekannte er noch 1826. Als 16-Jähriger reiste Beethoven nach Wien, um bei Mozart Unterricht zu nehmen. Inzwischen weiß man, dass Beethoven sich von Mitte Januar bis Ende März 1787 in der Musik-Metropole aufhielt. Mitte Februar kam Mozart aus Prag zurück. In den verbleibenden sechs Wochen hätte also eine Begegnung, ein Vorspiel oder mehr stattfinden können. Die Primärquellen schweigen dazu aber. (KW 36) E Ehrungen – hat Beethoven einige im Laufe seines Lebens erhalten. Gesellschaften in Wien und Österreich sprachen ihm Ehrenmitgliedschaften zu, aber auch Institutionen in Verona, Amsterdam und Schweden. Auf die Ehrung der königlich schwedischen Akademie war Beethoven so stolz, dass er sie in der Zeitung vermelden ließ. Und auf der Ankündigung zum Uraufführungs-Konzert der neunten Sinfonie sollten seinem Namen drei Ehrungen hinzugefügt werden, wie Titel. (KW 37) N Neefe – war einer der verschiedenen Musiklehrer des jungen Beethoven in Bonn. Als Theatermusikdirektor und Hoforganist spielte Christian Gottlob Neefe eine Rolle im Musikleben des kurfürstlichen Hofes. Durch seine Vermittlung kam der Druck einiger Lieder und Klavierwerke seines erst 11-/12-jährigen Schülers zustande. Neefe war ein Anhänger der Aufklärung. Von seiner humanistischen Gesinnung ist vermutlich auch etwas auf seinen jungen Schüler übergegangen. (KW 38) S Schubert – soll Beethoven verehrt und bewundert haben. So hat es Schuberts unmittelbare Nachwelt überliefert - und damit aus dem Beethoven-Mythos (Beethoven als Musik-Titan) einen Schubert-Mythos geschaffen: Schubert der Schüchterne, der sich von Beethovens Meisterschaft erdrückt fühlt. Dafür gibt es aber keine eigenhändigen Belege Schuberts. Im Gegenteil: Schubert hatte ein gutes kompositorisches Selbstbewusstsein, auch Beethoven gegenüber. Bei Beethovens Begräbnis war Schubert einer unter insgesamt 36 Fackelträgern aus dem Wiener Kulturleben. (KW 39) C Czerny – kommt als Name in Beethovens nahem Umfeld gleich zweimal vor. Carl Czerny, heute bekannt als Etüden-Komponist, wurde mit neun Jahren Klavierschüler von Beethoven. 15 Jahre später wurde Carl Czerny Klavierlehrer von Beethovens damals neunjährigem Neffen Karl, und weitere fünf Jahre später wurde er Lehrer des damals ebenfalls neunjährigen Franz Liszt. Auch Joseph Czerny war Pianist und namhafter Klavierpädagoge, ist aber nicht mit Carl Czerny verwandt. Auch Joseph Czerny war ein halbes Jahr lang Klavierlehrer von Beethovens Neffen. (KW 40) H_ Haydn – war über 13 Monate Beethovens Lehrer in Wien. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis endete, weil Haydn erneut nach England aufbrach – und nicht, weil Beethoven unzufrieden mit Haydns Unterricht war oder Haydn seinen jungen Schüler für eigensinnig und unwillig hielt. Wirkliche Spannungen zwischen den beiden Komponisten sind durch nichts zu belegen. Im Gegenteil: Beethoven schätzte Haydn zeitlebens, und auch Haydn begleitete seinen einstigen Schüler immer mit Wohlwollen und Interesse. (KW 41) U Unternehmer – in Sachen Musik war Beethoven als nicht fest Angestellter zwangsläufig. Er verkaufte seine eigenen Werke an Verleger, manchmal an verschiedene gleichzeitig, und verlangte gute Honorare. Für seine Akademien war er selbst Veranstalter und musste auch Säle mieten und Karten verkaufen. Auftragswerke waren eine weitere Einnahmequelle. Und Widmungen waren oft so kalkuliert, dass sie Zuwendungen zur Folge hatten. In all dem war Beethoven recht erfolgreich, obwohl er selbst immer über Geldnot klagte. (KW 42) N Nachlässe – sind ein Indiz für den Vermögensstand eines Verstorbenen. Beethoven hinterließ rund 8.000 Gulden an Bargeld und Aktien. Die Sachwerte machten noch einmal etwa 2.000 Gulden aus. 10.000 Gulden entsprechen – vorsichtig berechnet – ungefähr 150.000 Euro. Nur 5% der Wiener hinterließen damals mehr. Mozart dagegen hinterließ nur knapp 600 Gulden. Haydns Hinterlassenschaft wiederum betrug 55.000 Gulden, hälftig in bar und hälftig in Immobilien und Präziosen. (KW 43) D_ Deym – war er erste Ehe-Name von Josephine Brunswick. Beethoven war mit der Familie Brunswick gut befreundet. Josephine und ihre Schwester Therese wurden Beethovens Klavierschülerinnen. 1799 heiratete Josephine den Grafen Joseph Deym. Er starb im Januar 1804. Im Herbst 1804 begann ein Briefwechsel zwischen Beethoven und Josephine, der in 14 Briefen von einer großen Verliebtheit zeugt. Dass Josephine auch die Adressatin des von Beethoven im Juli 1812 verfassten Briefes an die „unsterbliche Geliebte“ war, wird heftig spekuliert. Dafür gibt es aber keine Belege. (KW 44) F Freimaurer – war Beethoven nicht, anders als zum Beispiel Mozart. Aber Beethoven identifizierte sich mit den Grundidealen der Freimaurerei: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Er hat sie in Schillers Gedicht „An die Freude“ gefunden, das Schiller übrigens für eine Freimaurerloge geschrieben hatte. Dieses Gedankengut umgab Beethoven schon in Bonn, wo Logenbrüder wie sein Lehrer Neefe, sein Geigenlehrer Franz Anton Ries und sein Orchesterkollege Nikolaus Simrock zu seinem Umfeld gehörten. (KW 45) R Revolutionär – war Beethoven auf musikalischem Gebiet zweifellos. Auch hat er sich immer für die Ideen der französischen Revolution (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) begeistert, denn auch er wollte „gleich“ sein. Beethovens eigene politische Haltung war allerdings eher ambivalent. Er selbst pflegte ein gutes Verhältnis zu dem ihn unterstützenden Adel, auch wenn er sich diesem gegenüber immer wieder Kritik und persönliche Freiheiten herausnahm. Seine Haltung brachte Beethoven selbst einmal auf den Punkt: „So republikanisch wir denken, so hat’s auch sein Gutes um die oligarchische Aristokratie“. (KW 46) E Einsamkeit – braucht ein Künstler für seinen Schaffensprozess. Clemens Brentano erkannte diese „innere Notwendigkeit einer ideellen Einsamkeit jedes schöpferischen Gemütes, das notwendig einsam ist“, wie er Beethoven in einem Brief schrieb. Tatsächlich brauchte und suchte Beethoven immer wieder diesen Rückzug. Er genoss aber auch die fröhliche Geselligkeit im Kreis von Freunden, obwohl ihm seine Ertaubung soziale Kontakte erschwerte. (KW 47) I_ Inwendig – sind die Gedanken, die sich in Beethovens zwischen 1812 und 1818 geführtem Tagebuch finden: über die zunehmende Ertaubung, die Liebe oder über Religion. An vielen Stellen des Tagebuchs wird Beethovens Konflikt zwischen dem Wunsch nach menschlichem Kontakt und der Priorisierung seiner Kunst deutlich. Immer wieder zieht Beethoven das Fazit, sein Glück letztlich in sich selbst und in seiner Kunst zu finden. Diese Sicht hat ihm schon früh eine starke innere Widerständigkeit, eine Resilienz, gegeben. (KW 48) S Spagnol – soll Beethoven als Kind wegen seiner etwas dunkleren Hautfarbe gelegentlich genannt worden sein. Davon ist auf Porträts nichts zu erkennen. Einen guten Eindruck von Beethovens Aussehen vermittelt die Büste des Bildhauers Franz Klein, die auf der Lebendmaske basiert. Aus Berichten von anderen Künstlern, die den Komponisten porträtierten, weiß man, dass Beethovens Augen blaugrau und sehr lebhaft waren. Seine Haarfarbe war dunkel bis schwarz. Mit ca. 168 cm war Beethoven von mittlerer Statur. (KW 49) E Europa – wurde während des Wiener Kongresses territorial neu geordnet. Und Beethoven war der künstlerische Star dieses Kongresses. Überhaupt wurde er schon zu Lebzeiten in vielen Ländern Europas gefeiert. Seine Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“ wurde später zur Europahymne, denn die Aussage „alle Menschen werden Brüder“ passt zum völkerverbindenden Gedanken Europas. War Beethoven somit bekennender Europäer? Die Kernaussage von Schillers Gedicht, das Ideal von der Gleichheit aller Menschen, war aber immer auch Beethovens Wunsch. (KW 50) I Isbach – hieß vermutlich der Pfarrer, der am 17. Dezember 1770 die Taufe von „Ludovicus“ in das Taufregister der Kirche St. Remigius in Bonn eintrug. Geboren ist Beethoven wohl einen Tag vorher, jedenfalls ging er selbst davon aus. Das legt ein Brief von Beethovens Wiener Lehrer Albrechtsberger nahe, der seinem Schüler zum Geburtstag am 16. Dezember gratuliert. Die damalige Taufkirche wurde später zerstört. Der Taufstein aber blieb erhalten und steht jetzt in der heutigen Bonner Remigiuskirche, der früheren Minoritenkirche. (KW 51) N Nur – als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden, unabhängig von Stand, Herkunft oder Vermögen, hatte sich Beethoven schon sehr früh gewünscht. „Wann wird auch der Zeitpunkt kommen wo es nur Menschen geben wird, wir werden wohl diesen Glücklichen Zeitpunkt nur an einigen Orten heran nahen sehen, aber allgemein – das werden wir nicht sehen, da werden wohl noch JahrHunderte vorübergehen“, schrieb er am 17. September 1795 an einen Bonner Freund. Vision oder Utopie? (KW 52) ! Ausrufezeichen – sind die Sforzati in Beethovens Briefen. Sie zeigen den leidenschaftlichen und humorvollen Charakter des Komponisten: Wertheste Verlegenheiten!!! / veni, vidi, vinci!!! / Sehr zuversichtlich!!! / summa summarum, Nichts! Nichts! Nichts!!! / großer Philosoph und Komikus!!!! / welches Leben!!!! so!!!! / Freyheit!!!! was will man mehr??? / bedenken sie, daß auch ich ein Freiherr bin, wenn auch nicht dem Nahmen nach!!!! / alles Schöne an ihre schöne Frau!!! (von mir)!!!!! / Reden, schwäzen über Kunst, ohne Thaten!!!!! / leben sie wohl auf der Deutschen Erde!!!!!! / Faschingslump!!!!!!!!!!!!! (KW 53)
|